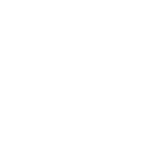Aktuelle Rechtssprechung

Leben in einer Mietwohnung zwei Mieter, die durch Ehe oder eine nichteheliche Lebensgemeinschaft verbunden sind, so ist für den Fall des Todes geklärt, dass der überlebende Mieter das Mietverhältnis nach Tod des anderen alleine fortsetzt, § 563 Abs. 1 BGB.

Mit Urteil vom 18.11.2015, VIII ZR 266/14 (GE 2016, 49), hat der Bundesgerichtshof die Frage, ob bei einer Mieterhöhung die tatsächliche oder die im Mietvertrag vereinbarte Wohnfläche zu berücksichtigen ist, neu entschieden. Grundsätzlich bleibt der Bundesgerichtshof bei der Auffassung, dass im Grundsatz die Angabe zur Wohnfläche im Mietvertrag eine Beschaffenheitsvereinbarung darstellt.

Zulässige Miete bei Vertragsabschluss und Mietpreisüberhöhung
Ab dem 01.06.2015 gilt das Mietrechtsnovellierungsgesetz und damit die sogenannte "Mietpreisbremse".
Bereits am 28.04.2015 hat der Berliner Senat beschlossen, dass Berlin insgesamt als Gemeinde mit angespannten Wohnungsmarkt anzusehen ist, so dass nunmehr ab 01.06.15 die Mietpreisbremse in ganz Berlin gilt. Ob die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen das Mietrechtsnovellierungsgesetz einerseits und gegen den Berliner Senatsbeschluss vom 28.04.2015 andererseits begründet sind, bleibt abzuwarten.

Das Widerrufsrecht des Mieters bei Haustürgeschäften
Mit der gesetzlichen Regelung vom 13.06.14 hat der Gesetzgeber die Richtlinie 2011/83 der EU vom 25.10.11 im Deutschen Recht umgesetzt und die Verbrauchsschutzrechte bei Haustür- und Fernabsatzgeschäften neu gestaltet.

Urteil des BGH vom 18.03.2015, Az. VIII ZR 185/14
Der Bundesgerichtshof entschied mit Urteil vom 18.03.2015, Az.VIII ZR 185/14, dass die Abwälzung der Schönheitsreparaturen auf den Mieter in all den Fällen unwirksam ist, in denen dem Mieter eine nicht komplett renovierte Wohnung überlassen wird.

Der Insolvenzverwalter kann Rückzahlungen nach § 133 InsO verlangen
Schließt der Vermieter mit dem Mieter eine Ratenzahlungsvereinbarung und wird später über das Vermögen des Mieters das Verbraucherinsolvenzverfahren eröffnet, so besteht für den Vermieter die Gefahr, dass er die geleisteten Raten zurück zahlen muss.

Am 23.05.13 wurde in Berlin der neue Mietspiegel veröffentlicht. In der Folge werden viele Vermieter bemüht sein, die vertraglich vereinbarte Miete durch einseitige Mieterhöhung nach § 558 BGB auf die ortsübliche Miete anzupassen.

Nach § 543 Abs. 2 BGB kann der Vermieter fristlos und nach § 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB fristgemäß kündigen, wenn der Mieter die Miete nicht in voller Höhe zahlt und über mehrere Monate ein Rückstand von zwei Monatsmieten entsteht oder in zwei aufeinander folgenden Monaten ein Rückstand von mehr als einer Miete.

1. Die Vereinbarung der Umlage der Betriebskosten
2. Die Abrechnung der Betriebskosten
3. Die Einhaltung der Abrechnungsfrist durch eine formal
wirksame Abrechnung
4. Die Einwendungen des Mieters gegen die materielle
Begründetheit der Abrechnung
5. Der Ausschluss von Einwendungen des Mieters
6. Vorauszahlungen auf die Betriebskosten
7. Betriebskosten in der Insolvenz
Weitere Beiträge …
Seite 2 von 3